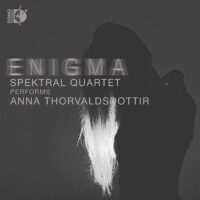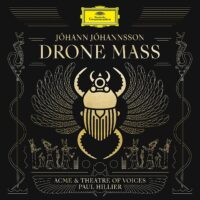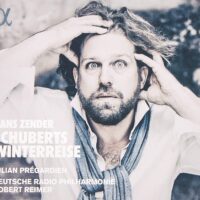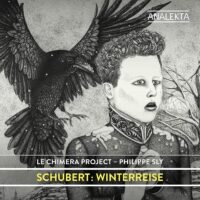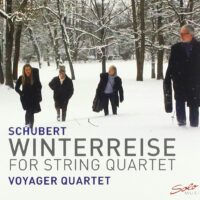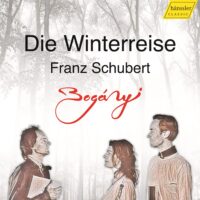Eloïse Bella Kohn
Große Werke fordern Konzentration. Und so ist es wohl auch kein Wunder, dass als Ergebnis von Lockdown und Konzertpause bei einigen Pianisten und Pianistinnen der Wunsch Realität wurde, sich grundsätzlich einmal mit Bachs «Opus summum», der Kunst der Fuge BWV 1080, gedanklich wie interpretatorisch auseinander zu setzen – einem Werk freilich voller Rätsel: angefangen bei der Frage der Abfolge der mit «Contrapunctus» überschriebenen Sätze und der ergänzenden Canones, endend mit dem Geheimnis um die Quadrupel-Fuge (zugespitzt formuliert: ob Bach sie doch schon vollendet hatte oder über ihr tragisch verschied). Aufführungspraktisch
Weiterlesen