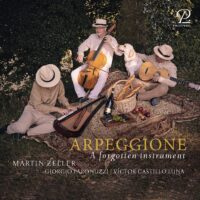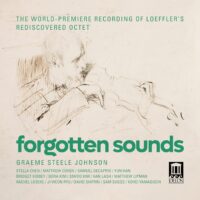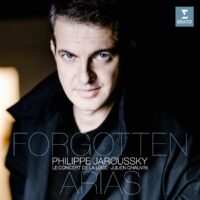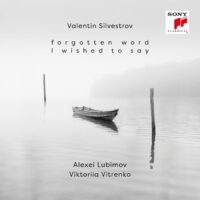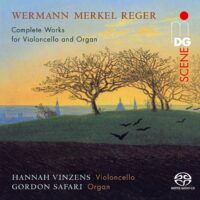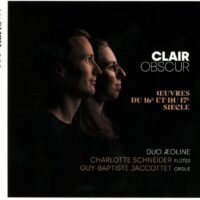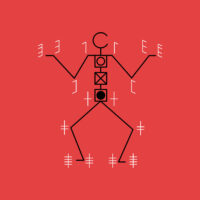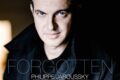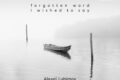forgotten Instrument
Fast alle Instrumente, die heute weltweit verbreitet sind, haben eine lange Tradition und eine weitgehend standardisierte Form. Dennoch wurden und werden immer wieder neue Instrumente erfunden, so auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Wien. Hier kam es zu einer interessanten Neuentwicklung, dem Arpeggione, der zweifellos auch die Zeit des Biedermeier widerspiegelt. Bei diesem 1823 vorgestellten Instrument handelt es sich um eine Mischung aus Gitarre und Violoncello, also um eine Streich- oder Bogengitarre, die aber auch als Guitarrenvioloncello bezeichnet wurde. Konstruiert wurde das in nur einem Exemplar erhaltene Instrument von
Weiterlesen