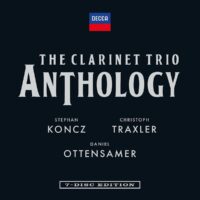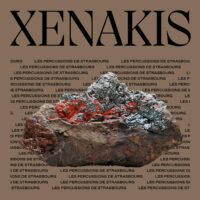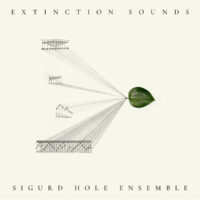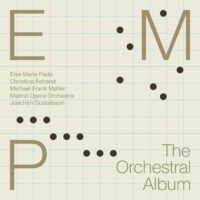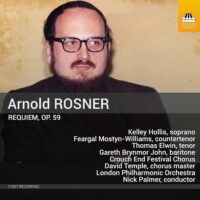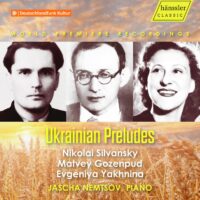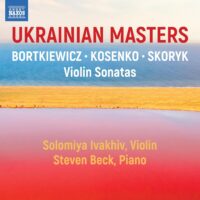Clarinet Trio Anthology / Daniel Ottensamer
Eine Produktion aus dunklen Corona-Zeiten. Wo viele mit schnellen Ideen vor-preschen (auch im präsent zu bleiben), da machte sich das (namenlose) Trio mit Daniel Ottensamer (Klarinette), Stephan Koncz (Violoncello) und Christoph Traxler (Klavier) auf, ein stattliches Repertoire aus mehr als 200 Jahren zu durchkämmen. Im Konzertsaal wie im Katalog ist diese wunderbare Besetzung, die auch bei der sieben CDs umfassenden Box in Anlehnung an das Klaviertrio nicht ganz ideal als «Klarinettentrio» bezeichnet wird (während das Klarinettenquintett mit Streichquartett definiert ist), meist nur durch Beethoven (op. 11) und Brahms (op. 114)
Weiterlesen