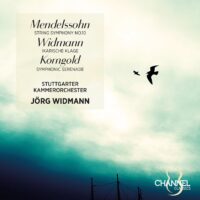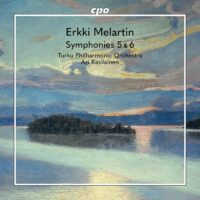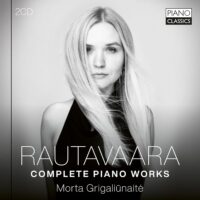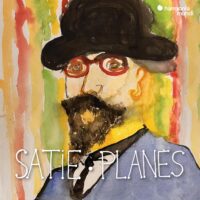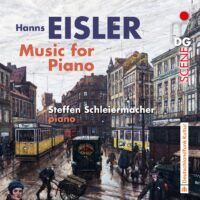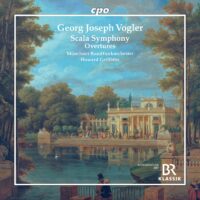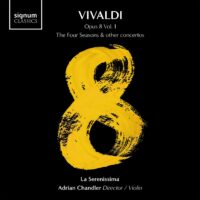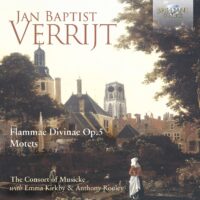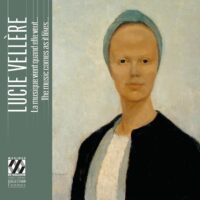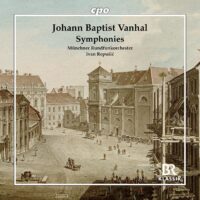Jörg Widmann – Stuttgarter Kammerorchester
Es ist ein Album, das mit seiner vielschichtigen Konzeption überzeugt. Im Zentrum steht dabei (auch was die Track-List angeht) Jörg Widmanns Ikarische Klage – eine frühe Komposition von 1999, gleichwohl schon wegweisend und keinesfalls für eine spätere Kanzellierung bestimmt. Um Ikarus und seinen Höhenflug geht es auch im übertragenen Sinne über alle drei Werke. Denn bei Felix Mendelssohn und Erich Wolfgang Korngold begann das kompositorische Schaffen schon früh im Kindes- und Jugendalter. Vom Himmel gestürzt ist freilich niemand. Auch wenn Mendelssohn bereits mit 38 Jahren starb, hinterließ er doch ein
Weiterlesen