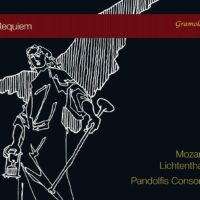
Die «Übersetzung» einer Komposition in eine andere Besetzung oder auch Gattung erfordert allerdings vom Bearbeiter handwerkliches Geschick und bei den Interpreten viel Gespür für die adäquate Umsetzung. Nun, Lichtenthal kannte «seinen» Mozart. Wo Singstimmen vorhanden sind, nimmt er deutlich Bezug; wo nicht, übernimmt er die Partitur für die vier Streicher – vielfach gar wörtlich, was zwar die Vorlage en detail abbildet, nicht aber in jedem Fall dem besonderen Klang des Streichquartetts gerecht wird. Das Pandolfi Consort denkt diesen Ansatz leider allzu entschieden fort. Man hört die Formation auf ihren Instrumenten geradezu die originalen Stimmen singen sowie charakteristische Klänge und Farben nachbilden (Dies irae). Gewonnen ist damit wenig. Mich hätte es eher interessiert, das Requiem wirklich im Gewand des Streichquartetts zu hören, abstrakter gedacht und als instrumentale(!) Musik umgesetzt. Hinzu kommt bei dieser Aufnahme ein sehr offenes, geradezu berückend ehrliches Klangbild, das bisweilen der Idee eines geschlossenen Ensembles entgegensteht, an manchen Stellen aber eine fast gamben-artige Fahlheit erzeugt. Dieses Missverständnis eröffnet allerdings weitere Überlegungen zur sinfonischen Satztechnik in der Kammermusik bei anderen Komponisten und ihren Werken…
Wolfgang Amadeus Mozart. Requiem d-Moll KV 626, arr. für Streichquartett von Peter Lichtenthal
Pandolfis Consort
Gramola 99188 (2018)
