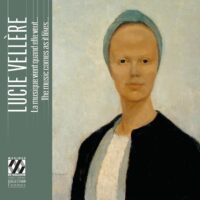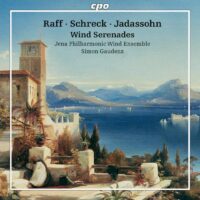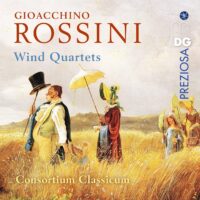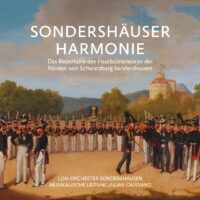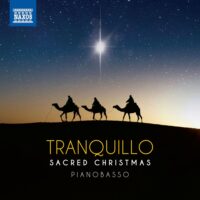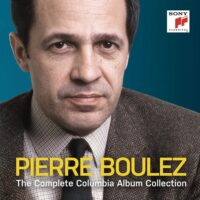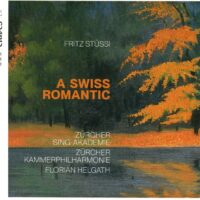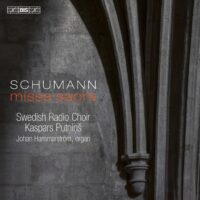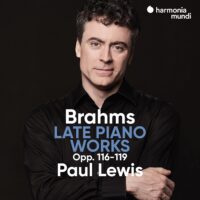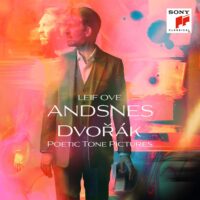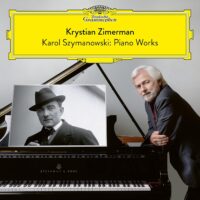Lucie Vellère – Kammermusik
Eine stille Stimme aus Brüssel, die ihre eigene Meisterschaft nie nach außen trug. Lucie Vellère (1896–1966) hielt es gar für überflüssig, den Großteil ihres etwa 80 Kompositionen zählenden Œuvres im Druck erscheinen zu lassen: «Verlage sind sehr teuer, und da ich von Grund auf unabhängig bin, […] wollte ich nie einer Gruppierung angehören, um mich von jeglichem Ehrgeiz fernzuhalten.» Tatsächlich knüpft ihre Musik an den einstigen Impressionismus an, interpretiert diesen jedoch konkreter. Aber das ist freilich nur eine erste Momentaufnahme – denn das Doppel-Album stellt nach eigener Auskunft vielfach die
Weiterlesen