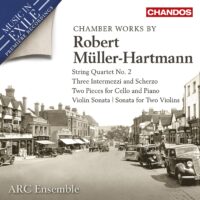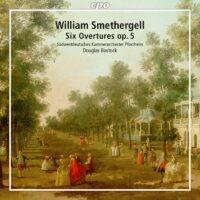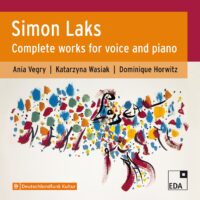
Simon Laks / Works for Voice and Piano
Wieder einmal ist dem Label EDA ein Coup gelungen. Schon seit Jahren steht alles andere als das Gewöhnliche programmatisch im Zentrum. Nahezu alle Produktionen dokumentieren den außergewöhnlichen Spürsinn für verlorene oder überhaupt erst zu entdeckende Komponisten, Sammlungen, Werke. Hier nun galt er nicht das erste Mal dem Schaffen des bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in Paris lebenden (und Auschwitz überlebenden) polnischen Komponisten Simon Laks (1901–1963), und zwar seinen sämtlichen Liedern, Gesängen und einem Melodram für Stimme und Klavier – jenen Werken, von denen er selbst einmal glaubte, sie würden am