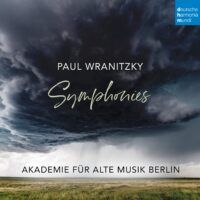
Die hier mit Ernst und Feuer eingespielten Sinfonien entstammen alle einer Zeit, in der die beiden Kollegen selben Jahrgangs (Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Martin Kraus) bereits verstorben waren. Die programmatisch angelegte, auch martialische Töne anstimmende Sinfonie op. 31 (1797) entstand in der Zeit der Koalitionskriege (fast zwei noch schlimmere Jahrzehnte sollten folgen), die Sinfonie D-Dur op. 36 dann 1799 zur Vermählung von Erzherzog Joseph und Großfürstin Alexandra Pawlowna Romanowa (1783–1801), die später am Kindbettfieber verstarb. Aus den 1790er Jahren stammt auch die Sinfonie d-Moll, die wegen ihres naturalistischen Finales zu Recht die Bezeichnung «La Tempesta» verdient. – Wer das Doppelalbum aufmerksam hört, wird sich viele Fragen stellen. Nicht nur nach der bisher wie in Beton gegossenen anhaltenden Generalpause in der Rezeption von Paul Wranitzky, sondern auch nach den möglichen Auswirkungen seiner Musik auf Haydn (vgl. das Adagio der d-Moll-Sinfonie), Beethoven, oder gar den ganz jungen Schubert (vgl. Beginn der Sinfonie D-Dur). Abgesehen von der beeindruckenden musikalischen Qualität der Kompositionen tun sich hier Kontexte auf, denen es nachzugehen gilt. Und Wranitzky selbst? Seine Werke könnten die einschneidenden stilistischen Veränderungen nach 1800 erklären helfen.
Paul Wranitzky. Ouvertüre zu «Oberon, König der Elfen»; Sinfonie c-Moll op. 31 «Grande Sinfonie caractéristique pour la paix avec la République française»; Sinfonie D-Dur op. 36; Sinfonie d-Moll «La Tempesta»
Akademie für Alte Musik Berlin, Bernhard Forck
Sony 19658702252 (2021)








